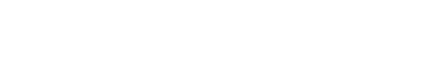Die Anlage wurde scheinbar vor der Europäischen Harmonisierung 1987 der Netzspannung auf 230/400V gebaut.
Genau. Was sagt uns die Angabe der NennSekundärSpannung, wenn wir nichts über die NennPrimärSpannung und die NennBelastung des Trafos und die tatsächliche PrimärSpannung und die tatsächliche Belastung erfahren. Wird der Trafo quasi im Leerlauf betrieben, ist natürlich eine höhere AusgangsSpannung zu erwarten. Der BrückenGleichrichter allein erhöht den EffektivWert der Spannung nicht.
Das wäre der Fall, wenn die Spannung noch durch einen Elko geglättet würde. Die NennPrimärSpannung des Trafos ist anscheinend deshalb mit 26,5 V gewählt worden, um den SpannungsAbfall am Gleichrichter und die SpannungsAbfälle an SchmelzSicherungen und auf den Leitungen zu den 24V-Verbrauchern zu kompensieren.
Es wird eine VentilSpule geschaltet, also eine induktive Last. Das Einschalten ist eigentlich unkritisch, sofern kein/kaum KontaktPrellen dabei auftritt. Kritisch ist aber das Ausschalten, weil der StromFluss schlagartig unterbrochen wird ... wenn keine "EntstörMassnahmen" vorhanden sind. Eine in SperrRichtung zur Spule parallel liegende Diode tut nichts, solange die Spannung an der Spule anliegt. Wird der StromFluss durch die Spule unterbrochen, so versucht der Strom unverändert weiterzufliessen und dank der Diode kann er das auch, denn das Ende der Spule, das vor dem Abschalten das negativere Potenzial hatte, hat jetzt das positivere Potenzial und für diese Polung ist die Diode durchlässig. Folgen: Das Relais bleibt etwas länger angezogen, weil der Strom weiterfliesst. An dem Schaltkontakt funkt es nicht, weil der Strom weiterfliesst und nicht "urplötzlich" unterbrochen wird. Der Strom nimmt natürlich ab, weil er am ohmschen Widerstand der Spule und in der Diode "verbraten" wird.
Sooo, wenn wir nun durch die Entstörung nicht mehr das Problem haben, dass der RelaisKontakt durch die FunkenBildung "aufgefressen" wird, kann es nur noch bedeuten, dass der Kontakt durch den SpulenStrom so stark belastet wird, dass er unzulässig stark erhitzt wird. D.h., dann wäre das Relais für die Last unterdimensioniert.
Kontakte in Reihe zu schalten hat den Sinn, die LuftStrecke zwischen den geöffneten Kontakten zu vergrössern, so dass die FunkenBildung früher bzw. überhaupt aufhört. Ensteht wegen der Entstörung kein Funke, so ist die Reihenschaltung witzlos.
Eine Enstörung durch Varistoren oder RC-Glieder ist nicht ganz so wirksam wie durch eine Diode, hat aber den Vorteil, dass auch die AbschaltVerzögerung nicht so wirksam ist.
Gegen die Verwendung eines Varistors, der für eine Spannung von 24 V dimensioniert ist, spricht allerdings die recht hohe Spannung von 41 V. Da müsste man mal schauen, dass man einen geeignet[er]en Typ findet.
PS:
Mit einer Diode lässt sich natürlich nur eine induktive Last entstören, die an einer GleichSpannung betrieben wird. Bei Betrieb an einer WechselSpannung könnte man an eine Beschaltung mit antiseriell geschalteten Z-Dioden denken, aber das entspricht schon ziemlich genau einer Beschaltung mit einem geeigneten Varistor.